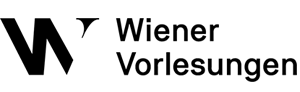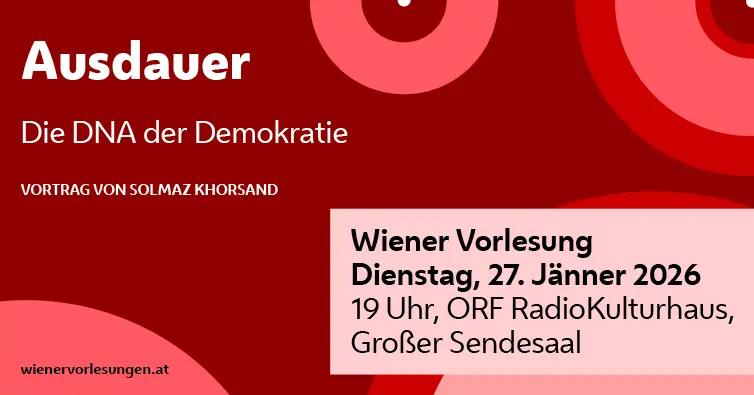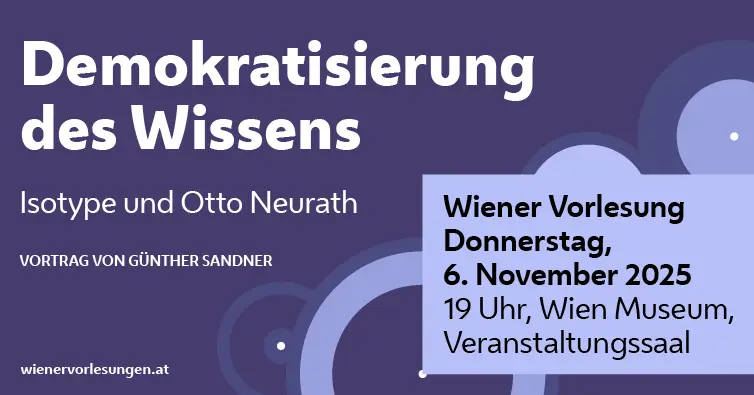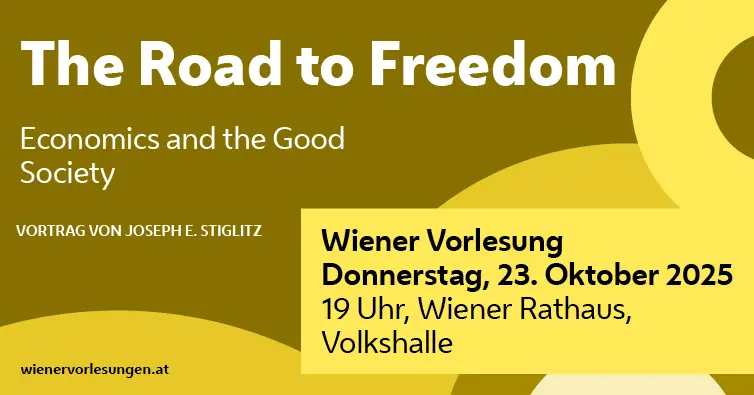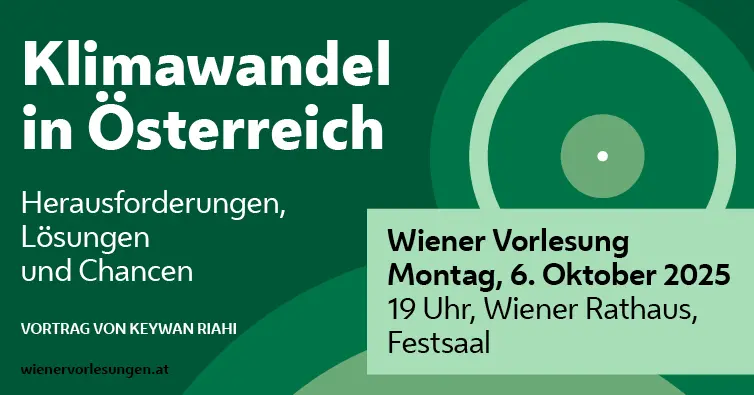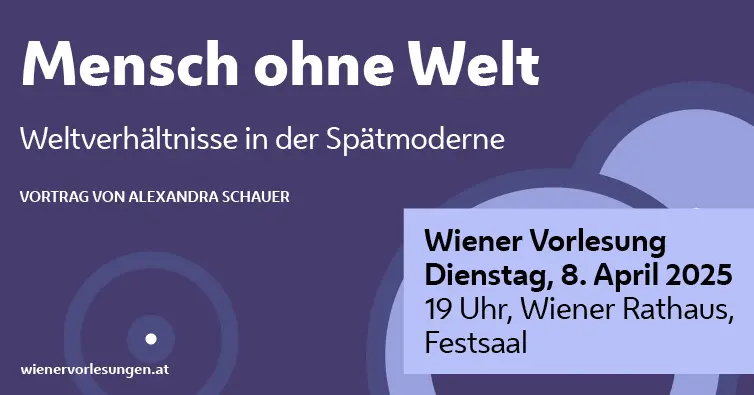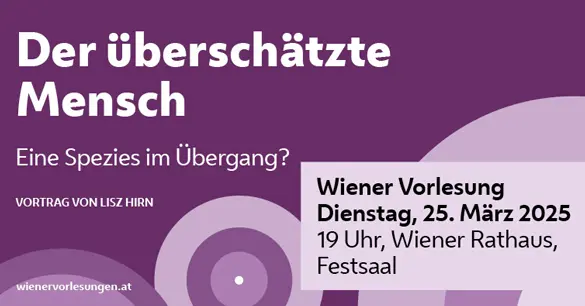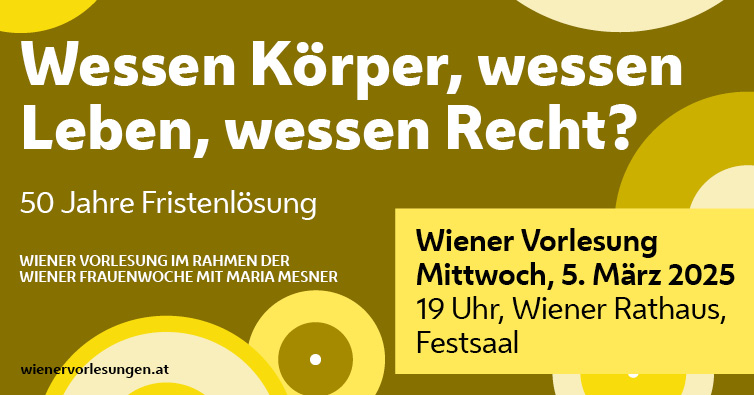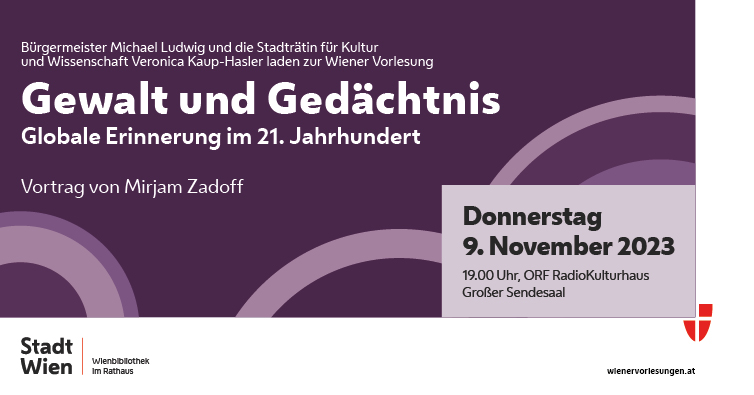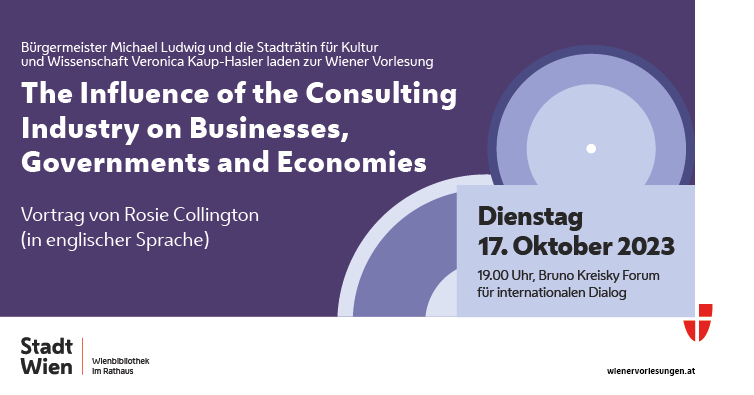Digitales Wettrüsten um die Weltherrschaft
Wer die Technologie hat, hat die Macht. So scheint die Erfolgsformel des digitalen Zeitalters zu lauten. Um die globale Vorherrschaft wetteifern derzeit die Technologie-Großmächte USA und China. Misha Glenny analysiert in seiner Wiener Vorlesung, wer hier in welchen Bereichen die Nase vorn hat – und welche Konsequenzen das für Europa hat.
Wie wird die Welt von morgen beschaffen sein? Und an welchen Themen entscheidet sich, wie sie aussehen wird? Misha Glenny, Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen, hat sich mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt. Entscheidend ist für ihn der aktuelle Wettstreit um die technologische Überlegenheit zwischen den USA und China. Wer dieses Match für sich gewinnt, hat auch enorme Bedeutung für Europa. Ein Gespräch über technologisches Wettrüsten, den Unterschied zwischen Fleiß und Geldverdienen sowie die Chancen der letzten Bastion der liberalen Welt.
Wiener Vorlesungen:
Was macht den technologischen Wettkampf zwischen den USA und China zum entscheidenden globalen Thema?
Misha Glenny:
Hier fließen die Ressourcen der beiden mächtigsten Länder der Welt zusammen. In den USA investiert man enorme Summen in KI, Robotik, Fernsteuerung und Waffensysteme. Chinas wichtigstes Industrieprogramm der letzten zehn Jahre ist Xi Jinpings „Made in China“, dessen erklärtes Ziel es ist, die USA in allen wichtigen Technologiesektoren zu überholen und so weltweit politische und wirtschaftliche Vorherrschaft zu erlangen. Beide Länder kommunizieren das ganz klar. Da ein Großteil der globalen Kommunikation von diesen beiden Ländern dominiert wird, betrifft dieses Match jeden Menschen weltweit.
Worin sehen Sie die technologischen Stärken der beiden Player?
China dominiert die Batterietechnologie sowie jene zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Windparks, Solaranlagen und Kernenergie. Das stellt vor allem in der Automobilindustrie eine existenzielle Bedrohung für die europäische Wirtschaft dar. Die USA sind überzeugt, aufgrund ihrer aktuellen Dominanz in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Mikrochips die weltweit führende Macht bleiben zu können. Dieses Bild wackelt jedoch, da chinesische KI-Modelle – allen voran DeepSeek – in weiten Teilen der Welt mittlerweile deutlich beliebter sind als US-Modelle.
Was sind die größten technologischen Unterschiede zwischen diesen beiden Welten?
Chinesische KI-Modelle sind deutlich günstiger als US-amerikanische. Und sie sind größtenteils Open Source, was bedeutet, dass jeder sie nutzen und weiterentwickeln kann. Daher finden sie in im globalen Süden so weite Verbreitung. In den USA hingegen steht bei KI die Gewinnerzielung im Vordergrund.
Wie sieht es in anderen technologischen Bereichen aus?
Die USA und China investieren enorme Summen in die Entwicklung neuer Waffensysteme – aktuell geht es um die Drohnenschwarmtechnologie. Dafür wird KI in Drohnen integriert, sodass die Taktik auf dem Schlachtfeld zunehmend nicht mehr vom Menschen gesteuert wird. Dabei geht es darum, dass Tausende von Drohnen gleichzeitig miteinander kommunizieren, Ziele identifizieren und sogar ohne menschliches Eingreifen einen Angriff starten. Das ist ein Thema, das Menschen weltweit beunruhigt.
Wie sieht es im Weltall aus?
Im Bereich der Satelliten- und Kommunikationstechnologie sind die USA besonders stark. Elon Musks Starlink verfügt über rund 10.000 Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn, was dem Land geopolitisch enorme Macht verleiht. Zum Vergleich: An zweiter Stelle steht das europäische Konsortium Eutelsat mit rund 640 Satelliten.
Viele Jahrzehnte hatte kaum jemand China als technologischen Player auf dem Radar – bis es plötzlich dominant da war. Wie konnte das geschehen?
US-Unternehmen waren rund 20 Jahre lang damit beschäftigt, durch die Ausbeutung billiger chinesischer Arbeitskräfte Profit zu machen. Da wurde eine gezielte Politik verfolgt, die Produktion von Technologieprodukten nach China auszulagern. In China hat man das sehr genau beobachtet, die Ingenieurtechniken analysiert und begonnen, parallel eigene zu entwickeln – in allen Bereichen. Da aber sowohl die deutsche Autoindustrie als auch die amerikanische Telekommunikationsbranche damit so viel Geld verdienten, kümmerte das niemanden.
Wie lief das in der digitalen Infrastruktur?
Hier war die Einführung der Großen Firewall Chinas entscheidend, die den Zugang zu US-amerikanischen digitalen Diensten einschränkte. Damals hielten wir die Große Firewall lediglich für ein Mittel der chinesischen kommunistischen Partei, um ihre politische Kontrolle zu sichern. Doch damit baute China letztlich seine gesamte digitale Dienstleistungsbranche von Grund auf selbst auf. Europa dagegen ist heute vollständig von US-amerikanischen digitalen Diensten abhängig. Salopp gesagt: Die USA könnten uns einfach das Internet abschalten.
Hat Europa noch eine Chance aufzuholen? Oder ist dieser Zug abgefahren?
Der Zug ist noch nicht abgefahren. Aber um ihn im Bahnhof zu behalten, braucht Europa zuerst einen einheitlichen Kapitalmarkt. Denn aktuell bekommen Start-up-Unternehmen nicht die nötigen Investitionen für wichtige Innovationen – weder von staatlichen Stellen noch vom privaten Sektor. Es braucht aber genau diese Produkte und die Forschung von Start-ups, um mit chinesischer und amerikanischer Technologie konkurrieren zu können.
Wie war das mit staatlicher Unterstützung in den USA und in China?
Die USA behaupten, ihre gesamte Digitalwirtschaft sei das Ergebnis des freien Marktes, des amerikanischen Erfindergeistes und der Privatwirtschaft. Tatsächlich hätten Elon Musk oder Apple ohne massive verdeckte staatliche Subventionen – allen voran vom Pentagon – nichts von dem erreichen können, was sie erreicht haben. Die Ökonomin Mariana Mazzucato etwa hat aufgezeigt, dass 90% der Technologie im iPhone durch staatliche Subventionen der USA in der einen oder anderen Form finanziert wurden. Von allen drei großen Handelsblöcken China, EU und USA ist es ironischerweise die EU, die sich dem Glauben an den Staat als Schlüsselfaktor Fortschritt verschrieben hat, jedoch am wenigsten bereit ist, die Staatsmacht zur Entwicklung einer Industriestrategie einzusetzen.
Wer hat im Augenblick die technologische Nase vorne – die USA oder China?
Donald Trump hat China auf spektakuläre Weise in die Hände gespielt. Seine Entscheidung, auf fossile Brennstoffe zu setzen, statt erneuerbare Energien auszubauen, hat dazu geführt, dass die Chinesen in diesen zukunftsweisenden Bereichen nun absolut alles dominieren.
China hängt seine Dominanz nicht an die große Glocke – im Gegensatz zu den USA. Warum?
Die Chinesen freuen sich, wenn sie in Führung liegen – und machen einfach weiter. Hier schadet den USA ihre Überheblichkeit. Der amerikanische Glaube, die USA seien zur Weltmacht bestimmt, ist ein echtes Problem – besonders wenn dem nicht mehr so ist.
Was wäre der größte Unterschied zwischen einer von den USA und einer von China dominierten Welt?
Schwer zu sagen, wir haben noch keine von China geführte Welt erlebt – außerhalb Chinas. Die Vorstellung, dass China ein Leuchtfeuer liberaler Ideen sein wird, ist unwahrscheinlich. Doch die USA scheinen sich aktuell auch vom Liberalismus abzuwenden und entwickeln sich zu einer Macht, die zunehmend willkürlich agiert.
Was bedeutet das für Europa?
Europa ist die letzte Bastion des Liberalismus und muss sich überlegen, wie es sich angesichts eines bösartigen Amerikas und eines bösartigen Chinas politisch, wirtschaftlich und militärisch verteidigen will.
Wie könnte das im besten Fall aussehen?
Europa kann nur dann die politische Kontrolle über seine Zukunft bewahren, wenn es gemeinsam handelt. Die von vielen Parteien vorangetriebene Fragmentierung Europas, die etwa zum Brexit geführt hat, zeigt die Folgen deutlich: Die britische Wirtschaft steht heute um 6% schlechter da als ohne Brexit. Großbritannien ist auf dem Scheideweg und muss sich entscheiden: Entweder wird es zu einer Art Außenposten der USA oder es tritt der EU in irgendeiner Form wieder bei. Die Europäische Union befindet sich aktuell in einer ähnlichen Lage. Sie ist gefangen zwischen den technologischen Supermächten China und USA. Entweder Europa rafft sich zusammen und agiert als geschlossene Einheit, oder es wird die Konsequenzen tragen müssen – wirtschaftliche Rückständigkeit und einen sinkenden Lebensstandard.
Verfasst von Judith Belfkih / Wiener Vorlesungen
Informationen zur Veranstaltung:
Wiener Vorlesung, 11.02.2026
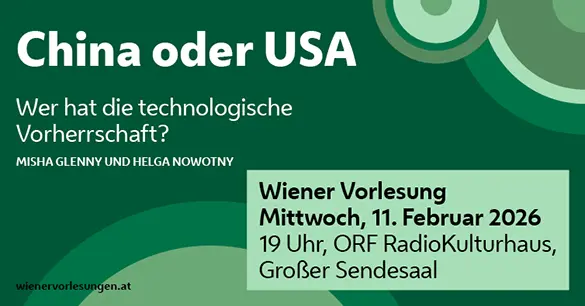
Misha Glenny

© Teresa Walton